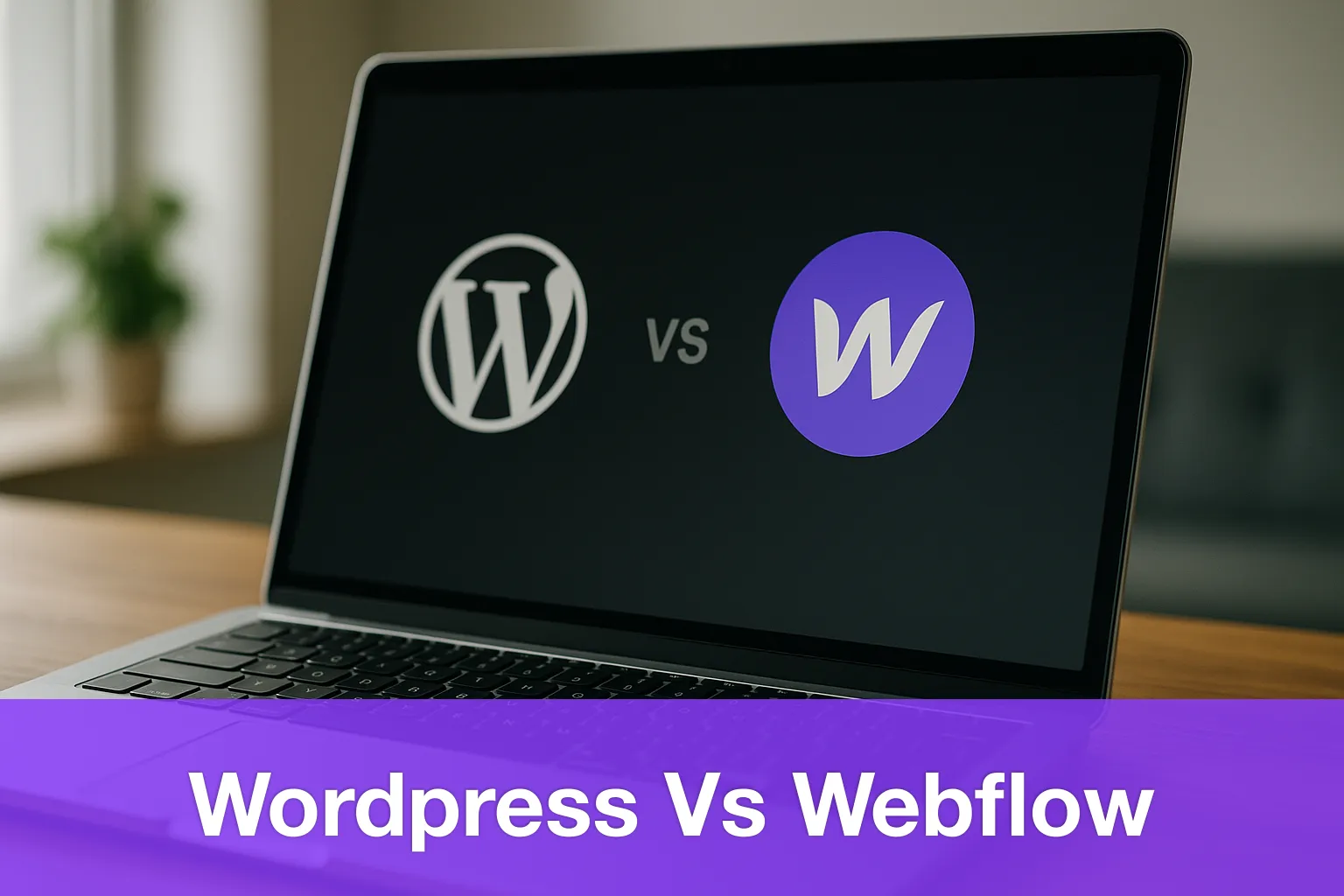Du planst eine neue Website und fragst dich: Brauche ich maximale Flexibilität oder lieber einen visuellen Workflow ohne Code? Reicht ein Baukasten, oder will ich volle Kontrolle über Hosting, Integrationen und Daten? Diese Fragen führen fast automatisch zu einer Kernentscheidung: WordPress vs Webflow. Beide Systeme liefern Blogs, Landingpages und Unternehmensseiten – nur der Weg dorthin fühlt sich sehr unterschiedlich an.
Damit du nicht in Buzzwords und Meinungen versinkst, schauen wir auf die Faktoren, die im Alltag wirklich zählen: Lernkurve, Team-Workflow, Kosten (Start und laufend), SEO/Performance sowie die praktische Seite von Design, Integrationen und Wartung. Außerdem streuen wir reale Beispiele ein, bei denen messbare Ergebnisse herauskamen – denn am Ende geht es um Zeit, Budget und Wirkung.
Kurz gesagt: Es gibt keine Einheitslösung. Aber es gibt ein klares Muster – je nachdem, wer du bist und was dein Projekt verlangt. Lies weiter, wenn du eine Entscheidung treffen willst, die auch in zwölf Monaten noch gut aussieht.
Kurzüberblick: WordPress vs Webflow – was du wirklich vergleichen solltest
Wer sich fragt, ob „WordPress oder Webflow“ passt, vergleicht oft nur Features. Wichtiger sind jedoch dein Team, dein Budget, deine Timeline und wie oft sich die Seite ändern wird. Es macht einen riesigen Unterschied, ob du allein bloggst, regelmäßig Marketing-Landingpages shippen musst oder eine stark integrierte Unternehmensseite mit vielen Spezialfunktionen planst. Für einen fairen Start ist hilfreich zu wissen, wann welches System seinen natürlichen Sweet Spot hat. Kleiner Spoiler: Es geht weniger um „Kann X das?“ und mehr um „Wie verlässlich, wie schnell und wie sauber?“ – im laufenden Betrieb.
Wann WordPress die bessere Wahl ist
WordPress glänzt, wenn du volle technische Kontrolle und maximale Erweiterbarkeit brauchst. Du kannst selbst hosten, jedes Detail deines Stacks wählen und bei Bedarf in den Code greifen. Komplexe Inhalte, Memberships, mehrsprachige Setups, Shop mit WooCommerce, Headless-Ansätze – alles machbar. Auch Compliance-Anforderungen (Datenstandort, Backups, Audit-Trails) lassen sich granular lösen. Kurz: Wenn du langfristig eine sehr individuelle Lösung aufbauen willst oder Abhängigkeiten minimieren musst, ist WordPress oft die sicherere Bank. Die gewaltige Plugin-Ökosphäre ist ein Plus – verlangt aber Verantwortung: Updates, Security, Performance-Tuning.
Wann Webflow die bessere Wahl ist
Webflow punktet, wenn Design-Tempo und visuelle Präzision im Vordergrund stehen. Du bekommst ein Handwerkzeug, das direkt in HTML/CSS denkt – mit sauberem Markup und starker Kontrolle über Animationen und Responsiveness, ganz ohne Plugin-Dschungel. Marketing-Teams lieben den kurzen Weg von Idee zu Live-Seite, inklusive CMS-Sammlungen, Redaktions-Editor und globalem Hosting. Für Corporate Sites, Portfolios, Kampagnen und Produkt-Landingpages ist das unschlagbar schnell. Grenzen? Sehr komplexe Integrationen, tiefe Geschäftslogik oder Self-Hosting sind nicht Webflows Revier. Wer das nicht braucht, profitiert von Fokus statt Feature-Flut. In einem Satz: Für designgetriebene Websites liefert Webflow oft schneller verlässlich gute Ergebnisse.
Lernkurve & Workflow: von Einsteiger:in bis Team
Zwischen „Ich will loslegen“ und „Unser Team arbeitet im Sprint“ liegen Welten. Genau hier entscheidet sich, ob du mit WordPress oder Webflow langfristig produktiv bleibst.
Einstieg und Selbstlerntempo
Wenn du alleine startest, ist das Anfassen entscheidend. In Webflow arbeitest du direkt am Layout – mit Box-Modell, Flex/Grid und Komponenten. Visuelles Denken, aber sehr nah an echtem CSS. Das beschleunigt das Verständnis für sauberes Frontend. WordPress ist modularer: Du wählst Theme oder Builder (z. B. Gutenberg, Block-Themes, Bricks), ergänzt Plugins und definierst die Architektur. Das ist extrem flexibel, aber die Lernkurve kann sprunghaft sein, wenn du Performance und Sicherheit von Beginn an mitdenkst. Ein praktischer Tipp: Lerne die Grundlagen deines gewählten Systems „idiomatisch“ – Webflow mit seiner Klassenlogik, WordPress mit Block-Patterns und Child-Themes. Das spart später viel Frust – und Stunden.
Ein kurzer Erfahrungswert aus einem Coaching: Eine Solo-Designerin erstellte ihren ersten One-Pager in Webflow in 2,5 Tagen und implementierte danach zwei weitere Landingpages pro Woche. Ihr erster WordPress-Versuch dauerte länger, weil Hosting, Theme-Tuning und Plugins Zeit fraßen. Andersherum schaffte ein technisch versierter Blogger mit WordPress in 48 Stunden ein performantes Blog-Setup, inklusive Analytics und Newsletter – dank Vorwissen und fertiger Patterns. Kontext ist König.
Zusammenarbeit von Design, Content und Dev
Im Team zählt der Fluss: In Webflow können Designer:innen den visuellen Kern bauen, während Redakteur:innen im Editor Inhalte pflegen – fast ohne Risiko, das Layout zu zerstören. Kommentare direkt am Element und Staging/Publishing sorgen für Tempo. In WordPress bekommst du starke Rollen- und Rechtesysteme, Preview-Workflows, Reusable Blocks und – mit passenden Plugins – auch Editorial-Kalender und Freigabeprozesse. Für Devs ist WordPress die offene Spielwiese (eigene Plugins, REST/GraphQL), Webflow dagegen bewusst geschützt – Integrationen laufen meist über APIs, Make/Zapier oder eingebettete Snippets.
Kleines Praxisbeispiel: Ein B2B-Marketingteam reduzierte mit Webflow den Zeitaufwand pro Landingpage von vier Tagen (Designer → Dev → QA) auf unter zwei Tage, weil das Hand-off praktisch entfiel. Ein anderes Team mit starker Dev-Kapazität blieb bei WordPress und baute Block-Patterns plus CI-Designsystem – Ergebnis: neue Seiten in Stunden, bei maximaler Code-Kontrolle. Unterschiedliche Wege, gleiches Ziel: schneller live.
Kosten & Preise: Startkosten, laufende Gebühren und Total Cost of Ownership
Budget ist nicht nur „Was kostet es heute?“, sondern „Was kostet es mich, das Ganze verlässlich zu betreiben?“. Deshalb lohnt sich der Blick auf Startkosten, laufende Gebühren und den berühmten Total Cost of Ownership (TCO).
Startkosten (Setup, Themes/Templates, Development)
WordPress kann extrem günstig starten: Domain plus günstiges Hosting, ein leichtgewichtiges Theme, ein paar freie Plugins – fertig. Realistisch kommen viele Projekte aber mit Premium-Theme (50–100 €), ggf. Page Builder (z. B. 59 €/Jahr), ACF Pro (ca. 49 €/Jahr) und erster Entwicklungszeit in Berührung. Beauftragst du eine Agentur, variieren Setups stark – vom schnellen Theme-Customizing (ab ein paar Hundert Euro) bis zur individuellen Entwicklung (mehrere Tausend Euro).
Bei Webflow ist das Setup schlank: Du kannst mit einem Template (50–150 $) starten oder frei gestalten. Der sichtbare Vorteil: kein Server, kein Plugin-Puzzle, sofort produktionsnah. Custom-Interaktionen und pixelgenaues Layout entstehen häufig schneller, weil die Designerin oder der Designer die „Dev-Schleife“ umgeht. Aufwändige Sonderlogik kann dagegen externe Entwicklung erfordern – hier gleichen sich die Welten wieder an.
Laufende Kosten (Hosting, Lizenzen, Apps/Plugins)
In WordPress liegen laufende Kosten vor allem in Hosting (5–25 € für Shared, 25–40 €+ für Managed), Plugin-Lizenzen (häufig 30–150 € pro Jahr) und Maintenance-Zeit (Updates, Backups, Security). Wer „lean“ baut, bleibt günstig – wer viel erweitert, landet höher. In Webflow zahlst du je Site-Plan (z. B. CMS-Plan rund 23 $/Monat, Business höher) und ggf. Workspace-Sitze; zusätzliche Kosten entstehen für Integrationen (z. B. Zapier/Make) oder Dritt-Tools. Dafür entfällt klassisches Server-Management. TCO-Faustregel: Wenig IT-Ressourcen und hoher Design-/Content-Output? Webflow fühlt sich oft günstiger an. Viele Integrationen, Self-Hosting, tiefe Individualisierung? WordPress rechnet sich langfristig.

Ein Drei-Jahres-Blick hilft: Rechne Setup plus Hosting/Lizenzen und deine Zeit (oder Agenturzeit). Das zeigt erstaunlich klar, welches Modell wirklich passt.
SEO, Performance & Skalierung im Vergleich
Sichtbarkeit beginnt bei sauberem HTML, klugem Content-Workflow und schnellen Ladezeiten. Und sie endet bei Skalierbarkeit, wenn Traffic und Content wachsen.
Onpage-SEO-Features & Content-Workflow
In Webflow steuerst du Titel, Meta-Descriptions, Open Graph, Alt-Texte, strukturierte Collections, saubere URL-Struktur, 301-Weiterleitungen und sitemaps.xml out of the box. In WordPress bekommst du das mit Plugins wie Yoast oder Rank Math sehr komfortabel – ergänzt um interne Verlinkung, Schema-Module und Content-Analysen. Entscheidender als das Feature-Set ist der Workflow: Wer Inhalte regelmäßig aktualisiert, profitiert von klaren Freigaben, Vorschau und redaktionellen Mustern. Webflow punktet hier mit dem Editor, WordPress mit ausgereiften Redaktions-Plugins und Block-Patterns. Für tiefe SEO-Themen wie strukturierte Daten lohnt sich ein Blick in die offizielle Dokumentation von web.dev zu Core Web Vitals, die unabhängig vom System gilt.
Ein Mini-Case: Ein Tech-Blog migrierte von einem überladenen WordPress-Theme zu einem leichten Block-Theme, aktivierte Caching/CDN und reduzierte das Markup – Ergebnis: LCP von 3,1 s auf 1,8 s, 18 % mehr organischer Traffic in acht Wochen. Ein Startup wechselte zu Webflow und halbierte sein LCP von 3,2 s auf 1,6 s – Content blieb gleich, nur das Frontend wurde sauberer. Moral: Der größte Hebel ist Performance-Hygiene.
Core Web Vitals, Hosting & Skalierung
Webflow liefert globales Hosting, CDN, Bildoptimierung und sauberes Rendering – das nimmt viele Fehlerquellen raus. WordPress skaliert hervorragend, braucht dafür aber das richtige Setup: performantes Theme, wenige und gut gewartete Plugins, Caching (z. B. serverseitig), CDN, Bildkomprimierung, ggf. Managed Hosting. Bei Lastspitzen kannst du WordPress vertikal/horizontal skalieren; Webflow nimmt dir das weitgehend ab, setzt aber Limits bei CMS-Items und Plan-Kontingenten. Für die meisten Unternehmensseiten sind diese Grenzen unkritisch.
Tipp: Miss zuerst, optimiere dann. Nutze Lighthouse/PageSpeed und die Search Console. Offizielle Ressourcen wie die WordPress.org-Plugin-Verzeichnisse und die Webflow University helfen bei Best Practices – unabhängig davon, welches Lager du favorisierst.

Design-Freiheit, Plugins/Integrationen & Wartung in der Praxis
Am Ende zählt, wie schnell du Änderungen umsetzen kannst – ohne jedes Mal Angst vor Folgen zu haben. Hier unterscheiden sich die Systeme spürbar im Alltag.
Für Designer:innen & Agenturen
Webflow ist für visuelles Arbeiten gebaut: Komponentensysteme, globale Stile, Interaction-Designer, präzise Kontrolle über Breakpoints. Ein konsistentes Designsystem lässt sich zügig abbilden und an Kund:innen übergeben; der Editor schützt das Layout, während Inhalte wachsen. Integrationen gelingen über einfache Einbettungen oder Automations-Tools – schnell genug für Kampagnen, stabil genug für Corporate Sites. Grenzen spürst du bei sehr komplexen App-Logiken oder wenn Self-Hosting Pflicht ist.
WordPress ist die offene Welt: Du kannst eigene Blöcke bauen, Plugin-Ökosysteme nutzen oder komplett headless gehen. Das ist mächtig – verlangt aber Wartung. Updates, Security, Kompatibilitätstests gehören in den Prozess. Agenturen lösen das über Maintenance-Verträge und klare Standards (leichte Themes, wenige Premium-Plugins, Deployment mit Staging). Wer das beherzigt, liefert hochperformante Sites mit maximaler Freiheit.
- Webflow: schneller Visual-Loop, starke Interaktionen, Layout-Sicherheit für Kund:innen.
- WordPress: grenzenlos erweiterbar, riesiges Ökosystem, volle Daten- und Hosting-Kontrolle.
- Integrationen: Webflow via Make/Zapier/API; WordPress nativ per Plugins oder custom.
- Wartung: Webflow wenig Pflege; WordPress erfordert planmäßige Updates und Monitoring.

Für KMU & interne Teams
KMU brauchen Tempo ohne Technikstress. In Webflow baust du Kampagnenseiten in Stunden, Content-Redakteur:innen arbeiten sicher im Editor, und das Hosting ist „aus den Augen, aus dem Sinn“. Für klassische Unternehmensseiten mit Blog und Ressourcen ist das ideal. In WordPress bekommst du dafür mehr Freiheit: Mehrsprachigkeit mit tiefen Anforderungen, komplexe Form-Workflows, Rollenmodelle, spezielle Compliance – alles realisierbar, aber mit mehr Moving Parts. Ein Marketingteam berichtete, dass es mit Webflow die Time-to-Publish um 35 % reduzierte; ein anderes Team blieb bei WordPress, weil ein CRM-Plugin und ein spezieller Freigabeprozess essenziell waren. Beide haben recht – je nach Ziel.
Ein Wort zu Ownership & Lock-in: WordPress lässt sich komplett exportieren, selbst hosten, sichern und migrieren – echte Portabilität. Webflow exportiert statisches HTML/CSS/JS, nicht aber CMS-Struktur/Logik. Das ist in Ordnung, solange du es bewusst entscheidest und Backups/Exports planst. Für strikte Compliance (z. B. spezifische Datenstandorte) ist Self-Hosting mit WordPress oft einfacher; für global verteiltes Hosting ohne Admin-Aufwand überzeugt Webflow.
Zum Abschluss klare Empfehlungen: Solo-Blogger:in mit Fokus auf Content? Ein schlankes WordPress-Setup ist oft optimal. Designgetriebene Agentur oder Marketing-Team mit vielen Landingpages? Webflow liefert dir Geschwindigkeit und Konsistenz. Komplexe Geschäftslogik, Membership, Shop oder besondere Compliance? Greife zu WordPress – oder kombiniere es headless mit einem modernen Frontend. Am Ende zählt nicht das Etikett, sondern wie reibungslos du liefern kannst. Tempo schlägt Theorie.
Hey, ich bin Karwl und das ist mein Blog. Ich liebe alles zu den Themen 🌱 Garten & Pflanzen, 🤖 KI & Tech, 🌐 Web & Coding und würde mich freuen, wenn du hier öfters mal vorbei schaust.